

Die Kiebitzwiese ist gesichert! Innerhalb von nur drei Monaten kamen so viele Spenden zusammen, dass die gesamten 9.770 m² Feuchtwiese für den Kiebitz gesichert werden konnten. Das war auch dringend notwendig, denn der Kiebitzbestand ist in Hessen um 95 % eingebrochen, da sein typischer Lebensraum von Feuchtwiesen mit Flutmulden bei uns immer seltener geworden ist. Dank der Spenden konnte Naturefund zusammen mit der HGON diese Feuchtwiese im Kinzigtal kaufen, die nun wieder in ein Kiebitzbiotop verwandelt wird.
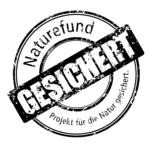

Der Kiebitz und mit ihm viele Arten werden immer seltener. Die intensive Landwirtschaft und die Trockenlegung von Feuchtgebieten reduzieren ihren Lebensraum dramatisch. Allein in Hessen ist der Bestand des Kiebitz ist in den letzten zwei Jahrzehnten um 95 % eingebrochen. Umso wichtiger sind Schutz und Renaturierung von Feuchtgebieten.
Das gemeinsame Projekt von Naturefund und die Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) hatte genau dies zum Ziel. In der Kinzigaue von Langenselbold hat die HGON bereits vor einigen Jahren ein 2,4 ha großes Gebiet erworben und Flutmulden sowie Senken ausgehoben. Innerhalb kürzester Zeit hat sich ein einzigartiges Naturparadies entwickelt. Im Somer 2010 konnte Naturefund zusammen mit der HGON eine angrenzende Fläche von 9.770 m² kaufen und damit das Schutzgebiet erweitern.
Die knapp 1 Hektar große Kiebitzfläche liegt im Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Kinzig“, das eine Gesamtfläche 126 km² umfasst. Die weiträumige, halboffene bis offene Auenlandschaft weist ein ausgeprägtes Bodenrelief auf. Durch dieses Bodenrelief gibt es temporär Senken und Flutmulden, die bei Hochwasser gefüllt werden und optimale Lebensbedingungen für alle Wiesenbrüter bieten, wie den Kiebitz und andere Regenpfeifervögel (Charadriiformes), auch Limikolen oder Watvögel genannt.
Die Flüsse Kinzig und der kleinere Hasselbach durchziehen das Gebiet. Bäume und Sträucher gibt es nur partiell in der Aue, und wenn, sind sie vor allem entlang der Kinzig vorhanden. Derzeit wird das Gebiet überwiegend als Grünland bewirtschaftet. Einige Äcker sind noch in die Wiesenlandschaft eingestreut. In etlichen Flutmulden entwickeln sich Feldgehölze mit einem hohen Weidenanteil.
Anfangs ermöglichte die landwirtschaftliche Nutzung mit kleinbäuerlicher und extensiver Bewirtschaftung eine starke Ausbreitung der Wiesenvögel in Hessen, wie wir sie bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts beobachten konnten. Die Langenselbolder Kinzigaue ist dafür ein gutes Beispiel. Das Kinzigtal hatte und hat nach wie vor als Brutgebiet sowie als Rast- und Durchzugsgebiet bestandsbedrohter Wiesenvogelarten regionale Bedeutung.
Seit den 1970er Jahren nahmen die Bestände rasant ab. Die Ursachen sind vielfältig: Eine stetig zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft mit starker Düngung, zu frühe Mahdtermine und die rigorose Entwässerung der Wiesen.
Als einzige wiesenbrütende Vogelart wich der Kiebitz zur Brut auf angrenzendes Ackerland aus, während andere Wiesenvögel fast ganz verschwanden. Dies hat aber für den Kiebitz den Nachteil, dass bei den Bearbeitungsgängen der Landwirte regelmäßig sehr hohe Verluste an Gelegen und Jungvögeln auftreten. Der Reproduktionserfolg auf Ackerflächen ist daher zur Populationserhaltung des Kiebitz viel zu gering.
Ziel ist es, dem Kiebitz und anderen wiesenbrütenden Vogelarten einen Lebensraum zu bieten, in dem sie während der Rast Nahrung aufnehmen und in der Brutsaison vom März und April eines jeden Jahres ungestört ihre Jungen aufziehen können. Zukünftig soll die Grünlandbewirtschaftung der Fläche stark extensiviert werden. Das bedeutet keinerlei Düngung und nur eine ein- bis höchstens zweischürige Mahd ab Juni.
Zusätzlich angelegte Flutmulden sollen die Nahrungssituation für Wiesenvögel, wie auch für den Storch verbessern helfen. Während der Brutzeit sind kurzrasige und vegetationsfreie Bereiche besonders hilfreich, da die Nahrung für Kiebitzküken durch eine Austrocknung des Bodens oder eine zu dichte Vegetation schnell abnimmt.
Hier finden Sie Informationen und Neuigkeiten zu diesem Projekt!
Start: Februar 2010
Ende: Mai 2010
Die Fläche zum Schutz des Kiebitz liegt im Main-Kinzig-Kreis mitten in der Langenselbolder Flussaue der Kinzig und ist von Feuchtwiesen umgeben. In direkter Nachbarschaft befindet sich einer der letzten bekannten Kiebitzbrutplätze in Südhessen.
Der Arbeitskreis Main-Kinzig der HGON hat vor einigen Jahren eine Fläche mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Gelnhausen als Ausgleichsmaßnahme für den Bau A45/A66 erfolgreich als Kiebitzbiotop renaturiert. Die Feuchtwiese, die Naturefund dank zahlreicher Spenden kaufen konnte, grenzt direkt an das bestehende Biotop an und erweitert den Lebensraum für den Kiebitz und für viele andere Arten auf 3,5 Hektar.
9.770 m²
Die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V. (kurz: HGON) ist Partnerin von Naturefund und wurde Eigentümerin der Fläche. Der Arbeitskreis Main-Kinzig der HGON wird den Kiebitzlebensraum langfristig betreuen.
Es ist leider noch kein Kommentar für dieses Projekt vorhanden. Schreiben Sie den Ersten!