

Unsere heimische Pflanzen- und Tierwelt ist in Gefahr. Viele Äcker und Wiesen werden ohne Rücksicht auf die Artenvielfalt oder den Erhalt der Natur bewirtschaftet. Die Folge: Unsere Landschaften werden von großen Äckern in Monokultur geprägt, während der Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen stetig schrumpft. Um dies zu ändern, schützen wir eine 6.800 m² große Blühwiese am Rande des Westerwalds, auf der viele heimische Pflanzenarten wachsen, die wiederum Schmetterlingen, Bienen, Vögeln und Co. Nahrung, Schutz und Lebensraum bieten.
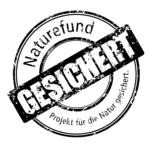
Start: April 2022
Ende: noch offen
In Merenberg, einer Gemeinde in Mittelhessen am Südrand des Westerwalds
6.800 m²

Naturnahe Wiesen sind Hotspots der Biodiversität und beherbergen bereits auf kleiner Fläche eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen, unter ihnen oft auch zahlreiche gefährdete Arten. Der Erhalt dieser Wiesenlebensräume bildet daher eine wichtige Maßnahme zum Erhalt der Biodiversität. Doch solche artenreichen Blühwiesen sind in Gefahr: Das Ökosystem Grasland gehört derzeit zu denjenigen Lebensräumen in Deutschland, welche sich in einem besonders kritischen Zustand befinden. Grund dafür ist, dass bis zu 75 % dieser Flächen aktiv bewirtschaftet werden – also gedüngt, gemäht und geschleppt werden – und sich daher in einem besonders schlechten Zustand befinden. Artenreiche und naturnahe Wiesentypen müssen laut der Biodiversitätskonvention daher unbedingt erhalten und gefördert werden.
Gerade Blühflächen stellen wertvolle Ersatzlebensräume in ausgeräumten Agrarlandschaften dar. Diese dienen nicht nur als Nahrungs-, Rückzugs- und Bruthabitate für Insekten, sondern sind auch eine Quelle von Nützlingen zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Mehrjährige Blühflächen und artenreiche Wiesen sorgen zudem für den Aufbau von Humus und dienen damit als wichtige Kohlenstoffspeicher.
Die in unserem Projekt zu schützende Blühwiese liegt in Merenberg in Mittelhessen am Rand des Westerwaldes. Die circa 6.800 m² große Wiese ist eingebettet in Hochwaldflächen mit alten Buchen und Eichen und wird zudem abgegrenzt durch den Vöhlerbach. Bisher wurde die Wiese einmal jährlich zur Heuernte gemäht und extensiv bewirtschaftet. So blieb eine reiche Artenvielfalt bestehen, die wir weiterhin erhalten möchten.
Auf der Wiese befindet sich eine Vielzahl unterschiedlichster Lebensräume von mageren Flächen über feuchte Stellen bis hin zu wechselfeuchten Bereichen. Entsprechend hoch ist die hier vorkommende Anzahl an Tier- und Pflanzenarten. So konnten bei einer Begehung im Juni 2021 acht Vogelarten, darunter der Eisvogel sowie das in seinem Bestand stark gefährdete Braunkehlchen entdeckt werden. Auch zwei Libellenarten kommen hier vor, ebenso wie sechs Schmetterlingsarten, unter ihnen der stark gefährdete helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling und der auf der Vorwarnliste stehende dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Zudem ist auch die auf der Blühwiese vorkommende Pflanzenvielfalt beeindruckend: 31 Pflanzenarten konnten bei der Begehung gezählt werden, darunter in ihrem Bestand rückläufige Arten wie der große Wiesenknopf oder die Sumpf-Dotterblume sowie gefährdete Arten wie der gewöhnliche Augentrost.
Solch artenreiche Wiesen mit ihren vielfältigen kleinteiligen Lebensräumen werden auch am Projektstandort im Westerwald immer seltener. Grund dafür ist unter anderem die anhaltende intensive Bewirtschaftung von Flächen und die Ausdehnung meist monotoner Ackerflächen rund um die Waldflächen. Wir wollen das wertvolle Biotop daher dauerhaft für die Natur erhalten. Auch, da die Wiese sich als „Trittstein“ eignet. Also so gelegen ist, dass sich die auf ihr vorkommende Artenvielfalt auf umliegende Flächen verteilen kann.
Vor Ort übernimmt die hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) die Koordination, langfristige Biotoppflege und Betreuung der Blühwiese. So muss diese einmal im Jahr naturgerecht gemäht werden, um eine Verbuschung zu vermeiden und das wertvolle Biotop zu erhalten. Auch eine weitere Erfassung der auf der Wiese vorkommenden Arten und deren durchgängiges Monitoring sind geplant.
Hier finden Sie Informationen und Neuigkeiten zu diesem Projekt.












Es ist leider noch kein Kommentar für dieses Projekt vorhanden. Schreiben Sie den Ersten!